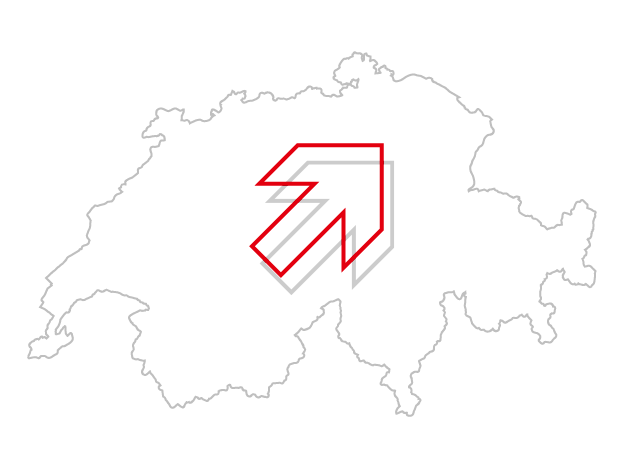Lehrstellenmarkt
«Die Betriebe wollen ausbilden, weil sie Nachwuchs brauchen»
Seit Jahren bleiben viele Lehrstellen unbesetzt. Welche Branchen sind betroffen? Wie reagieren die Lehrbetriebe? Was passiert, wenn ab 2018 wieder mehr Jugendliche auf Lehrstellensuche gehen? Katrin Frei* vom Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI kennt die Antworten.

Seit 2010 vermeldet das Lehrstellenbarometer (siehe Kasten) stets dieselbe Erkenntnis: Das Lehrstellenangebot übertrifft die Nachfrage. Ist das eine positive oder eine negative Nachricht?
Das kommt auf den Blickwinkel an. Von 2003 bis 2010 hatten wir eine Lehrstellenkrise. Verglichen damit haben wir heute sehr entspannte Verhältnisse. Das gilt insbesondere für Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Etwas anders sehen es die Betriebe: Sie würden – angesichts des Fachkräftemangels – gerne mehr ausbilden. Rund 10 Prozent der ausgeschriebenen Lehrstellen können zurzeit nicht besetzt werden.
Trotz Überangebot tun sich viele Jugendliche schwer, eine Lehrstelle zu finden. Wie kommt das?
Dafür sehe ich primär drei Ursachen. Erstens: Die Berufswünsche der Jugendlichen decken sich nicht immer mit dem Angebot auf dem Lehrstellenmarkt. Gewisse Berufe sind beliebt, andere weniger. Zweitens: Einige Jugendliche können ihre Stärken und Schwächen schlecht abschätzen. Sie bewerben sich auf Lehrstellen, deren Anforderungsprofil sie nicht erfüllen. Drittens: Ein Teil der Jugendlichen ist auf schulischer oder persönlicher Ebene noch nicht reif für die Lehre.
Welche Möglichkeiten haben diese Jugendlichen, sich auf den Lehreinstieg vorzubereiten?
Für jene, die schulische Lücken aufarbeiten oder ihre Berufswahl festigen müssen, gibt es Brückenangebote – zum Beispiel das berufsvorbereitende Schuljahr. Wer auf dem Weg zur Lehrstelle auf individuelle Begleitung angewiesen ist, findet diese in Coaching- oder Mentoring-Programmen sowie beim Case Management Berufsbildung. Diese Angebote wirken: In der Schweiz schliessen 95 Prozent der Jugendlichen, welche die obligatorische Schulzeit vollständig in der Schweiz absolviert haben, eine berufliche Grundbildung oder eine Mittelschule ab.
Betrachten wir die Situation der Betriebe: Wo gibt es zu viele, wo zu wenige Lehrstellen?
Aus Sicht der Betriebe gibt es immer die richtige Anzahl Lehrstellen, aber nicht alle werden nachgefragt. Dies war beispielsweise 2016 in den Berufsfeldern Bau, Büro und Technik der Fall. Dafür gibt es im Gesundheitswesen, in der Informatik und im Verkauf mehr Interessenten als Lehrstellen.
Wieso bieten Branchen, die bei Jugendlichen auf grosses Interesse stossen, nicht einfach mehr Lehrstellen an? Den meisten fehlt es schliesslich an Fachkräften.
Die Ursachen sind je nach Branche unterschiedlich. Im Gesundheitswesen wurden neue Ausbildungsprofile geschaffen. Es braucht Zeit, bis diese in den Betrieben etabliert sind. Hinzu kommt, dass nicht alle Interessierten das Anforderungsprofil der Gesundheitsberufe erfüllen. Bei den Informatikberufen haben wir das Problem, dass viele Betriebe, die Fachleute nachfragen, nicht ausbilden, weil sie in einer ganz anderen Branche tätig sind – im Finanzwesen, in der Industrie, im Handel. Zudem gibt es viele Jungunternehmen, für die ausbilden nicht erste Priorität hat. Sie müssen sich zuerst auf dem Markt etablieren.
Andere Branchen würden gerne mehr ausbilden, finden aber nicht genügend Lernende. Wie reagieren sie auf diese Situation?
Sie investieren in Information, in Werbung, ins Image. Mit Roadshows, mit Schulbesuchen, über Soziale Medien usw. versuchen sie, mehr Jugendliche und Eltern zu erreichen. Einige traditionelle Berufe ändern sogar die Berufsbezeichnung. Sie signalisieren damit, dass sie sich verändert haben und modern sind. So heisst der Käser heute Milchtechnologe. Eine weitere Möglichkeit ist, über gute Löhne und Arbeitsbedingungen Anreize zu setzen.
Gibt es Betriebe, die sich aufgrund der schwierigen Situation aus der Ausbildung zurückziehen oder ihre Ausbildungsinfrastruktur zurückfahren?
Gemäss Lehrstellenbarometer werden 95 Prozent der nicht besetzten Lehrstellen im Folgejahr wieder ausgeschrieben. Wir stellen also keinen signifikanten Rückzug fest. Die Betriebe wollen ausbilden, weil sie qualifizierten Nachwuchs brauchen. Allerdings gibt es eine kontinuierliche Fluktuation: Berufe verlieren an Bedeutung, Unternehmen stellen den Betrieb ein usw. Innerhalb von drei Jahren gehen so 20 Prozent der Lehrstellen verloren. Aber es werden ebenso viele in anderen Bereichen und in neuen Betrieben geschaffen. Die Lehrstellenförderer der Kantone spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie pflegen den Kontakt zur Wirtschaft und unterstützen die Betriebe beim Auf- und Ausbau der Ausbildung.
Ab 2018 drängen aufgrund der demografischen Entwicklung wieder mehr Jugendliche auf den Lehrstellenmarkt (siehe Kasten). Besteht die Gefahr einer neuen Lehrstellenkrise?
Kaum. Wir haben aus der Lehrstellenkrise gelernt und wirkungsvolle Instrumente entwickelt. Bei Bedarf können wir die Lehrstellenförderung intensivieren: Die Bereitschaft der Betriebe, mehr Lehrstellen anzubieten, dürfte angesichts des aktuellen Fachkräftemangels gross sein. Darüber hinaus haben wir den Lehrstellennachweis geschaffen, der Angebot und Nachfrage besser zusammenführt. Und wir haben die erwähnten Brückenangebote für Jugendliche ohne Lehrstelle geschaffen. Sie können bei einem kurzfristigen Nachfrageüberhang als Puffer wirken.
* Katrin Frei leitet beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI das Ressort Berufsbildungspolitik.
Links
Lehrstellenbarometer
Das Lehrstellenbarometer erfasst die aktuelle Situation und die kurzfristigen Entwicklungstendenzen auf dem Lehrstellenmarkt. Die Daten werden seit 1997 zweimal pro Jahr erhoben und beruhen auf schriftlichen Befragungen von Unternehmen und auf telefonischen Befragungen von Jugendlichen (14 bis 20 Jahre).
Link
Demografische Entwicklung
Die Zahl der Lernenden im 1. Lehrjahr einer beruflichen Grundbildung war zwischen 2008 und 2015 weitgehend stabil. Für den Zeitraum von 2015 bis 2018 rechnet das Bundesamt für Statistik mit einem Rückgang um 2 Prozent. Danach werden – primär aus demografischen Gründen – wieder mehr Jugendliche in eine berufliche Grundbildung eintreten. Das Referenzszenario geht von einem Wachstum von 9 Prozent bis ins Jahr 2025 aus.
Link