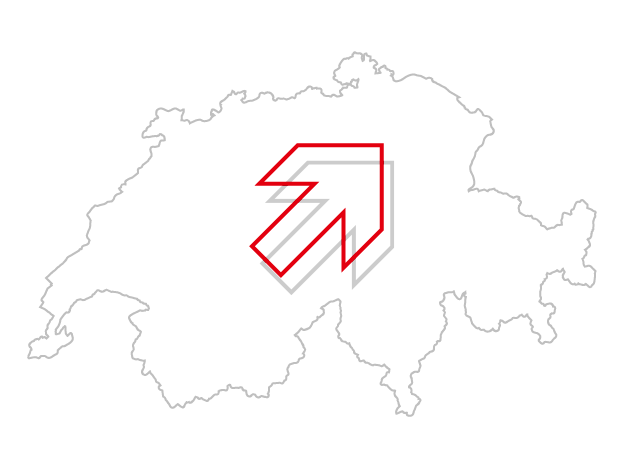Lehrstellenmarkt
«Der Lehrstellenmarkt ist seit zwei Jahrzehnten stabil»
Wie hat der Lehrstellenmarkt auf die Corona-Pandemie reagiert? Und: Ist er in der Lage, genügend Lehrstellen für die steigende Zahl an Schulabgängerinnen und Schulabgänger zu schaffen? Im Gespräch: Bildungsökonomin Ursula Renold.

Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es die Befürchtung, der Lehrstellenmarkt könnte einbrechen. Wie sieht die Situation fast zwei Jahre danach aus?
Sehr gut. In einigen Regionen präsentiert sich die Gesamtsituation sogar besser als vor der Pandemie. Die düsteren Prognosen einiger Wissenschaftler sind also nicht eingetroffen.
War der Lehrstellenmarkt über alle Branchen hinweg stabil oder gab es Verschiebungen?
Branchen, denen ein Teil des Geschäfts wegbrach oder die stark von den Einschränkungen das Bundesamts für Gesundheit betroffen waren, konnten 2020 und 2021 weniger Lehrstellen besetzen. Dies gilt insbesondere für die Gastronomie, den Detailhandel sowie die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Im Gesundheitswesen, in der kaufmännischen Branche und in der Informatikbranche wurden dafür mehr Lehrverträge abgeschlossen.
Die Konjunktur ist 2020 um rund 3 Prozent eingebrochen. Wieso hatte das insgesamt keine Auswirkungen auf das Lehrstellenangebot?
Weil die Unternehmen die Berufsbildung als Investition betrachten, nicht als Kostenfaktor. Fahren sie ihr Engagement zurück, fehlen ihnen in drei bis vier Jahren dringend benötigte Fachkräfte. Der Lehrstellenmarkt ist deshalb seit bald zwei Jahrzehnten äusserst stabil.
Die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe ist also ungebrochen hoch?
Ja. Insbesondere bei der produzierenden KMU-Wirtschaft. Die meisten Kaderleute in diesen Betrieben sind ebenfalls mit einer Lehre ins Erwerbsleben gestartet. Für sie ist ausbilden eine Selbstverständlichkeit. Sie wollen ihr Know-how weitergeben – und zwar so, wie sie es selbst erworben haben. Zudem ist ihnen sehr bewusst, dass sie über die Berufsbildung genau jene Fachleute bekommen, die sie in ihren Betrieben benötigen.
Die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger wird bis 2029 um rund 12 Prozent ansteigen. Wird die Wirtschaft die notwendigen Lehrstellen bereitstellen?
Ich bin optimistisch – vorausgesetzt, wir überlassen nichts dem Zufall. Wir müssen den Lehrstellenmarkt mit einem guten Monitoring beobachten und die Wirtschaft darauf hinweisen, dass es künftig mehr Lehrstellen braucht. Hier sind alle Verantwortlichen gefordert.
Wie kann der Staat mithelfen, Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht zu halten?
Bund und Kantonen müssen – gemeinsam mit den Organisationen der Arbeitswelt –informieren und sensibilisieren. Das bedeutet: Informationskampagnen starten und das Lehrstellenmarketing ausbauen.
Sind die entsprechenden Instrumente vorhanden oder müssen sie erst geschaffen werden?
Eine Lehrstellenknappheit hatten wir auch zu Beginn der 2000er-Jahre. Aus dieser Zeit gibt es viele bewährte Instrumente, die man wieder aktivieren kann.
In keinem anderen Land hat die Berufsbildung einen derart hohen Stellenwert wie in der Schweiz. Ist dieses Bildungsmodell auch in Zukunft konkurrenzfähig?
Mehr denn je – insbesondere wegen der digitalen Transformation und der steigenden Bedeutung der übertragbaren Kompetenzen. Die duale Berufsbildung kann diese Kompetenzen besser vermitteln als rein schulische Angebote.
Das müssen sie erklären.
Die Betriebe stehen im Wettbewerb. Deshalb arbeiten sie in der Regel mit den neuesten digitalen Technologien. Wer in der Praxis lernt, ist daher auf dem neuesten Stand. Auch was die übertragbaren Kompetenzen – Methoden-, Sozial- und Problemlösungskompetenz – betrifft, ist die Praxis im Vorteil. Wer in einem Team arbeitet, kann richtiges Verhalten von Vorbildern adaptieren.
Mit anderen Worten: Die Berufsbildung hat Zukunft.
Ja. Die Universitäten werden demgegenüber stärker gefordert sein, den Anschluss ihrer Absolvierenden an den Arbeitsmarkt sicherzustellen. Es braucht immer mehr Praktika, um ins Erwerbsleben einzusteigen. Das zeigt: Den Betrieben entstehen Einarbeitungskosten.
Zur Person
Ursula Renold ist Professorin für Bildungssysteme an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Zu ihren Forschungsprojekten gehört der «Lehrstellen-Puls». Er identifiziert die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Berufslehren, Lehrbetriebe und Jugendliche in der Schweiz. Ursula Renold war vor ihrer Tätigkeit an der ETH Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie. www.lehrstellenpuls.ch