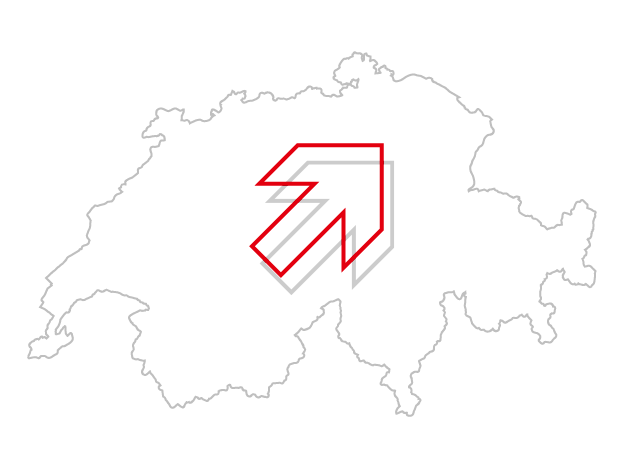Sozialer Status der Berufsbildung
«Unsere Botschaft lautet: Informiert die Migrationsbevölkerung»
Wie hat sich der soziale Status der Berufsbildung im Vergleich zum Gymnasium entwickelt? Gibt es Unterschiede zwischen den Landesteilen und verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Die KOF Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich ist diesen Fragen nachgegangen. Im Gespräch: Thomas Bolli.

Im jüngsten Bildungsbericht steht, dass 40 Prozent der Bevölkerung der Berufsbildung einen tieferen sozialen Status beimessen als der Allgemeinbildung. Nur 10 Prozent sehen das umgekehrt. Hat die Berufsbildung ein Imageproblem?
Nein, sonst würden sich nicht zwei Drittel aller Jugendlichen für diesen Weg entscheiden. Dieser Anteil ist seit Jahren stabil.
Sie haben das Image bzw. den sozialen Status der Berufsbildung erforscht. Warum?
Die Berufsbildung kann ihre starke Stellung nur wahren, wenn sie für leistungsstarke Jugendliche attraktiv bleibt. Bricht diese Gruppe weg, kann die Berufsbildung langfristig ein Verliererimage bekommen – so wie in anderen Ländern. Ein weiterer Grund: Bisher gab es kaum wissenschaftliche Untersuchungen zur öffentlichen Wahrnehmung der Berufsbildung. Wir wollten herausfinden, inwieweit gewisse Vorurteile mit der Realität übereinstimmen.
Wie misst man den sozialen Status der Berufsbildung?
Wir haben die Bildungsentscheide der Jugendlichen betrachtet – insbesondere jener Jugendlichen, die zwischen Gymnasium und Berufsbildung wählen können. Unsere Bemessungsgrundlage: Je höher die Wertschätzung der Berufsbildung in Wirtschaft und Gesellschaft, desto mehr gut qualifizierte Jugendliche entscheiden sich dafür. Grundlage für unsere Arbeit bildeten die PISA-Studien zu den durchschnittlichen Lese- und Mathematikkompetenzen.
Ihre Studie liefert überraschende Erkenntnisse. Überraschung eins: Der soziale Status der Berufsbildung ist seit Jahren stabil. Trotzdem klagen die Lehrbetriebe, dass immer mehr Jugendliche ans Gymnasium gehen. Wie kommt das?
Klar ist: Die Berufsbildung hat in den letzten Jahren nicht an Attraktivität gegenüber dem Gymnasium verloren. Wir vermuten deshalb, dass es sich primär um ein gefühltes Problem handelt, das zudem regional sehr unterschiedlich wahrgenommen wird.
Woher kommt dieses Gefühl?
Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ein Grund könnte die Internationalisierung der Wirtschaft sein. Viele ausländische Führungskräfte bringen aus ihrem Heimatland ein negatives Bild der Berufsbildung mit – sie taugt nicht für Leistungsstarke. Ein anderer Grund könnte das «Upskilling» sein, also die Tatsache, dass von den Berufsleuten heute mehr verlangt wird als früher. Wer erwartet, dass alle Fertigkeiten bereits in der Grundbildung vermittelt werden, dürfte die Berufsbildung als weniger wertigen Weg betrachten. Man muss die Berufsbildung aber als Ganzes sehen, zusammen mit der höheren Berufsbildung und der Durchlässigkeit aufgrund der Einführung der Berufsmaturität und der Fachhochschulen.
Überraschung zwei: Junge Frauen und Männer beurteilen den sozialen Status der Berufsbildung praktisch gleich. Wieso entscheiden sich deutlich mehr Mädchen fürs Gymnasium?
Mädchen haben höhere PISA-Kompetenzen. Folglich erfüllen sie eher die Voraussetzungen fürs Gymnasium. Darüber hinaus müssen wir spekulieren. Das Gymnasium ist tendenziell sprachlastig. Dieses Profil kommt Mädchen entgegen, sie verfügen gemäss PISA über mehr Sprachkompetenz. Hinzu kommt, dass Jungs eher schulmüde sind.
Überraschung drei: In der Westschweiz und im Tessin geniesst die Berufsbildung einen höheren sozialen Status als in der Deutschschweiz – obwohl in der Deutschschweiz deutlich mehr Jugendliche eine Berufsbildung absolvieren. Wie kommt das?
Das war eine grosse Überraschung. Unser Erklärungsansatz: Eine höhere Maturitätsquote führt zu einem tieferen Kompetenzniveau des Gymnasiums und reduziert gleichzeitig die Exklusivität des Abschlusses. Das drückt auf das Image des Gymnasiums. Relativ dazu steigt der soziale Status der Berufsbildung.
Was seit Längerem bekannt ist: Die Berufsbildung geniesst bei der Migrationsbevölkerung deutlich weniger Kredit als bei der einheimischen. Was sind die Gründe?
Hauptgrund ist der ungleiche Wissensstand hinsichtlich des Schweizer Bildungssystems. Je länger Jugendliche in der Schweiz leben, desto höher schätzen sie den sozialen Status der Berufsbildung ein. Mit der Zeit gleicht er sich jenem der in der Schweiz geborenen Jugendlichen an. Der entscheidende Faktor ist also der Wissensstand.
Unterschiede gibt es auch zwischen Stadt und Land. Warum liegt der soziale Status der Berufsbildung in der Stadt tiefer als auf dem Land?
Eine mögliche Erklärung ist, dass man als Akademikerin oder Akademiker auf dem Land schlechtere Karriereaussichten als in der Stadt hat, weil beispielsweise Banken in Städten eher eine Forschungsabteilung haben als auf dem Land. Zudem dürfte die Berufsbildung im Alltag der Menschen auf dem Land viel präsenter sein und die Wertschätzung entsprechend höher. Und: In entlegenen Regionen ist der Zugang zum Gymnasium auch heutzutage noch aufwendiger.
Welche Empfehlungen leiten Sie aus Ihrer Studie für die Bildungspolitik ab?
Unsere zentrale Botschaft lautet: Informiert die Migrationsbevölkerung über das Schweizer Bildungssystem. Wir müssen ihr die Vorteile und die Eigenheiten der Berufsbildung in einem möglichst frühen Stadium aufzeigen und die Botschaft mitgeben, dass man dank der Berufsbildung in leitende Positionen aufsteigen und gutes Geld verdienen kann. Kurz: dass die Berufsbildung gute Karriereaussichten ermöglicht und das Bildungssystem durchlässig ist.
Das heisst: Es braucht Informationskampagnen?
Davon bin ich überzeugt. Kampagnen wie BERUFSBILDUNGPLUS.CH tragen dazu bei, den sozialen Status der Berufsbildung aufrecht zu erhalten. Gerade vor dem Hintergrund der Internationalisierung müssen wir dazu Sorge tragen. Sonst könnten wir langfristig in eine Abwärtsspirale geraten. Der Fokus sollte aber stärker auf die Migrationsbevölkerung und die urbanen Gebiete ausgerichtet werden.
Könnte die Internationalisierung nicht auch umgekehrt wirken? Viele Länder interessieren sich heute für die Berufsbildung der Schweiz und möchten diese übernehmen. Das könnte den Status der Berufsbildung nachhaltig stärken.
Ja, aber nur, wenn die Berufsbildung auch in derselben Breite und Qualität umgesetzt wird, wie in der Schweiz. Wird sie bloss als Auffangbecken für Leistungsschwächere verstanden, könnte sich das auch in der Schweiz negativ auf den sozialen Status auswirken.
Die Studie
Die Studie «Der soziale Status der Berufsbildung in der Schweiz» wurde von der KOF Konjunkturforschungsstelle, ETH Zürich, in Zusammenarbeit mit der Hirschmann-Stiftung durchgeführt. Autoren: Dr. Thomas Bolli, Ladina Rageth, Dr. Ursula Renold.
Download Informationsbroschüre für Fachleute aus der Berufsbildung: Link