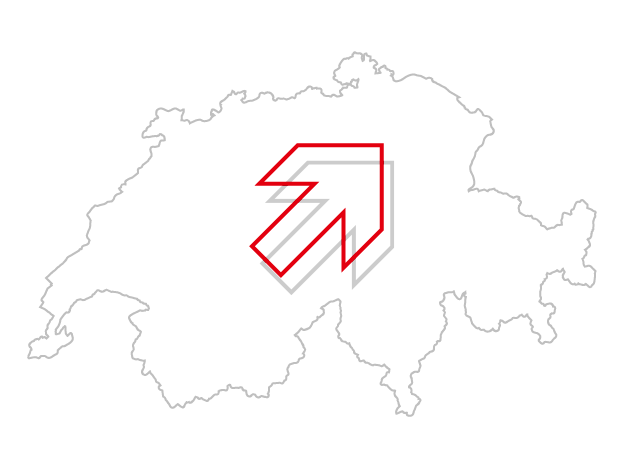Image der Berufsbildung
«Das Vertrauen in die Berufsbildung ist auf hohem Niveau stabil»
Wie gut bereitet die Berufsbildung auf eine Arbeitswelt vor, die sich immer schneller wandelt? Diese Frage stellt die Universität Bern Schweizerinnen und Schweizern – mit interessanten Ergebnissen. Im Gespräch: Studienleiter Stefan C. Wolter*.

Die Berufswelt wandelt sich immer schneller. Was sind die Treiber?
Die Digitalisierung, die Automatisierung sowie neue Bedürfnisse der Gesellschaft. Die Berufsbildung muss sich diesen Entwicklungen anpassen.
Bedeutet dies, dass viele Berufe verschwinden und neue entstehen?
Nein. Der Blick zurück zeigt, dass Berufe selten aussterben und selten neue entstehen. Vielmehr passen sie sich dem technologischen und strukturellen Wandel an. Quantitativ, indem mehr oder weniger Menschen bestimmte Berufe ausüben, qualitativ, indem neue Kompetenzen in die Berufe integriert werden. Ein gutes Beispiel ist die kaufmännische Grundbildung. Sie wurde schon oft totgesagt mit dem Hinweis, der Computer werde viele Arbeiten übernehmen. Aber sie ist nach wie vor die meistgewählte Lehre in der Schweiz. Entscheidend ist, dass sich die Berufe laufend reformieren. Das ist heutzutage der Fall.
Die Hälfte der Werktätigen mit Berufslehre arbeitet allerdings fünf Jahre nach Lehrabschluss nicht mehr im erlernten Beruf. Zielt die Berufsbildung am Arbeitsmarkt vorbei?
Nein. Die meisten Wechsel sind mit Weiterbildung, einem beruflichen Aufstieg und einem höheren Verdienst verbunden. Die hohe Mobilität ist also positiv zu werten und nur möglich, weil die Berufsbildung Kompetenzen vermittelt, die übertragbar sind – also auch ausserhalb des erlernten Berufs ihren Wert behalten.
Die Berufsbildung bereitet also gut auf den Wandel vor. Sie untersuchen, in wieweit die Schweizer Bevölkerung diese Einschätzung teilt. Warum ist es wichtig, dies zu wissen?
Glauben die Leute nicht mehr daran, dass die Berufsbildung fit für die Zukunft macht, raten sie ihren Kindern von einer Lehre ab. Das erhöht den Druck auf die Mittelschulen. Zudem trifft die Stimmbevölkerung bildungspolitische Entscheide. Unsere Befragung liefert Steuerungswissen für Politik und Verwaltung. Deshalb haben wir übrigens ausschliesslich Schweizerinnen und Schweizer befragt.
70 Prozent der Befragten finden, die Berufsbildung bereite «gut» oder «sehr gut» auf den Wandel vor. Ein erfreuliches Resultat?
Sehr erfreulich. Wir haben in den letzten dreizehn Jahren fünf Befragungen durchgeführt. Sie zeigen: Das Vertrauen in die Berufsbildung ist auf hohem Niveau stabil. Während der Lehrstellenkrise der 90er-Jahre hätte das Resultat anders ausgesehen.
78 Prozent finden sogar, die Berufsbildung bereite besser oder gleich gut wie die Allgemeinbildung (Mittelschulen/Hochschulen) auf die digitale Arbeitswelt vor. Erstaunlich?
Jain. Selbst Eltern mit akademischer Bildung sehen, dass Absolventinnen und Absolventen der Berufsbildung ökonomisch erfolgreich sind und erteilen ihr im Schnitt die besseren Noten als der Allgemeinbildung. Trotzdem schicken sie ihre Kinder lieber ans Gymnasium, weil akademische Bildung den höheren sozialen Status geniesst.
Wie kommt das?
Ein Uni-Abschluss wird selbstredend mit Intelligenz assoziiert, weil die Ausbildung lange dauert. Bei der Berufsbildung denkt man zuerst an körperliche Arbeit – obwohl viele Berufe im Büro beheimatet sind. Je mehr ein Beruf mit Kraft und Routine in Verbindung gebracht wird, desto tiefer sein sozialer Status. Schliesslich denken viele Leute, eine akademische Bildung garantiere einen hoch dotierten Job. Dabei finden 88 Prozent der Akademikerinnen und Akademiker nie ins Top-Management.
Sie haben im November 2019 und im Juni 2020 Daten erhoben. Dazwischen liegt der Corona-Schock. Hat sich die Wahrnehmung der Berufsbildung verändert?
Kaum. Nur eine interessante Veränderung stellen wir fest: In der Westschweiz beurteilt die Bevölkerung die Berufsbildung bezüglich Vorbereitung auf den digitalen Wandel heute signifikant besser – besser auch als die Deutschschweiz. Vor Corona gab es in dieser Frage keine Unterschiede zwischen den Landesteilen.
Wie erklären Sie sich das?
Ich kann nur spekulieren. Es könnte damit zu tun haben, dass die Berufsfachschulen – insbesondere in der Westschweiz – den digitalen Fernunterricht deutlich besser gemeistert haben als die Mittelschulen.
*) Stefan C. Wolter ist Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) und Leiter der Forschungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität Bern
Zur Befragung
«Wie schätzen Sie die Fähigkeiten der Schweizer Berufsbildung (Lehrabschluss, höhere Berufsbildung oder Fachhochschulabschluss) ein, die Jugend erfolgreich auf eine Arbeitswelt vorzubereiten, in der sich die Berufe immer schneller wandeln?» Diese Frage stellte die Universität Bern 6000 Schweizerinnen und Schweizern. Im Magazin «Panorama» ist dazu der Artikel «Wird die Berufsbildung den Wandel meistern?» erschienen. www.panorama.ch/zeitschrift