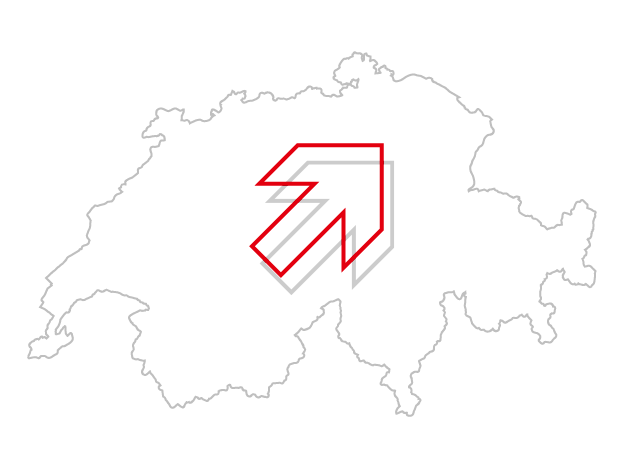Lehrstellenmarkt
«Der Lehrstellenmarkt erweist sich als krisenresistent»
Corona-Krise und eine steigende Zahl an Schulabgängerinnen und Schulabgängern: Ist der Lehrstellenmarkt dem Druck gewachsen? Die Frage geht an Rémy Hübschi, Vizedirektor des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.

Die Schweiz erlebt die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Öl-Schock der 1970er-Jahre. Trotzdem wurden 2020 mehr Lehrverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Erstaunt?
Ja. Noch im März hätten wir nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Aber der Lehrstellenmarkt erweist sich einmal mehr als krisenresistent. Die Betriebe wissen: Damit wir morgen genügend Fachkräfte haben, müssen wir heute ausbilden.
Eine von der ETH publizierte Befragung zeigt: 84 Prozent der Lehrbetriebe wollen nächstes Jahr gleichviele oder mehr Lehrstellen als 2020 anbieten. Wird es auch 2021 genügend Lehrstellen geben?
Das Ergebnis der Befragung ist erfreulich. Sie wurde aber vor der zweiten Corona-Welle durchgeführt. Wir wissen also nicht, wie sich die Situation effektiv entwickeln wird. Wir müssen jetzt darauf achten, dass Berufswahl, Lehrstellensuche und Selektionsverfahren wegen der Pandemie nicht ins Stocken geraten, dass Schnupperlehren, Informationsveranstaltungen und Bewerbungsgespräche weiterhin stattfinden können. Das alles ist durch Online-Angebote nicht vollwertig zu ersetzen.
Wie werden Bund und Kantone reagieren, sollten als Folge der Wirtschaftskrise mehr Lehrbetriebe schliessen oder Lehrstellen abbauen als erwartet?
Bundesrat Guy Parmelin hat im Frühjahr die Task Force «Perspektive Berufslehre 2020» eingesetzt, in der der Bund, die Kantone und die Wirtschaft vertreten sind. Sie beobachtet die Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt. Gibt es Probleme, werden bewährte Instrumente eingesetzt: Lehrstellenförderung, Beratung und Coaching von Lehrstellensuchenden, Support von Lernenden, die ihre Lehrstelle verlieren. Die Kantone können diese Massnahmen bei Bedarf rasch umsetzen bzw. ausbauen. Der Bund unterstützt Projekte von Verbundpartnern mit einem Förderschwerpunkt.
Die demografische Entwicklung wird den Lehrstellenmarkt in den nächsten Jahren zusätzlich belasten. Im Kanton Bern steigt die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger bis 2027 um voraussichtlich 17 Prozent. Ist das verkraftbar?
In den letzten Jahren konnten Tausende von Lehrstellen nicht besetzt werden. Es gibt also einen Puffer. Ich bin überzeugt, dass wir damit und dank der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe auch künftig genügend Lehrstellen haben werden. Bisher hat der Lehrstellenmarkt auf demografische und konjunkturelle Schwankungen immer flexibel reagiert.
Welche Möglichkeiten haben Bund und Kantone, den Lehrstellenmarkt nötigenfalls zu stützen?
Es sind primär die oben skizzierten Massnahmen. Zusätzlich können wir Massnahmen der Berufsverbände fördern, beispielsweise den Aufbau von Lehrbetriebsverbünden oder von neuen Ausbildungsmodellen. Wir müssen das Berufsbildungssystem nicht umbauen. Innovationen helfen uns, die Berufsbildung auf Kurs zu halten.
Letztlich wird es nur genügend Lehrstellen geben, wenn die Betriebe weiterhin vom Nutzen der Berufsbildung überzeugt sind. Sind sie das?
Ja, das zeigen aktuelle Untersuchungen zur Ausbildungsbereitschaft. Sie ist ungebrochen hoch. Die Wirtschaft betrachtet die Berufsbildung als Standortvorteil im internationalen Wettbewerb.
Warum?
Weil sie arbeitsmarktgesteuert ist, also berufliche Qualifikationen vermittelt, welche auf dem Arbeitsmarkt effektiv nachgefragt werden. Wir entwickeln die Berufsbildung permanent weiter, um sie noch attraktiver zu machen für die Betriebe – aber auch für die Jugendlichen. Und wir investieren in die Kommunikation, um die vielfältigen Chancen der Berufsbildung aufzuzeigen.